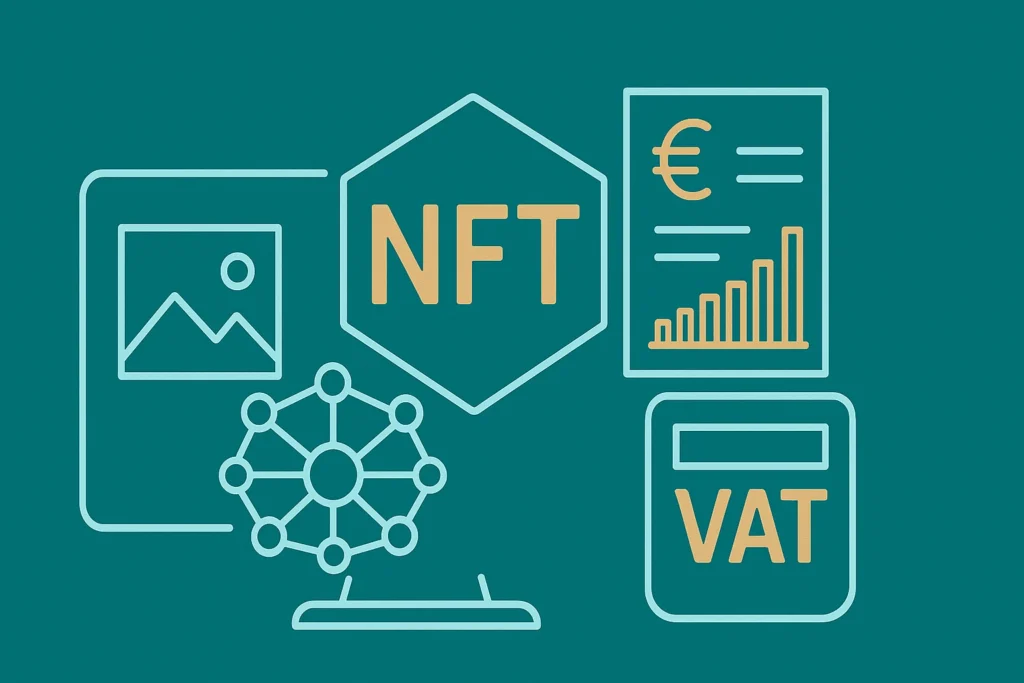Non-Fungible Tokens (NFTs) haben den Kunst- und Digitalmarkt revolutioniert – und zugleich viele steuerliche Fragen aufgeworfen.
Wie sind NFT-Verkäufe umsatzsteuerlich zu behandeln? Gilt der ermäßigte Steuersatz für Kunstwerke? Und was passiert, wenn die Käufer anonym über Blockchain-Plattformen agieren?
Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 10. Juli 2025 (Az. 5 K 26/24) erstmals umfassend zur Umsatzsteuerpflicht von NFTs entschieden – und damit wichtige Weichen für Händler, Künstler und Sammler gestellt.
Der Sachverhalt: Handel mit digitalen Kunst-NFTs über OpenSea
Ein deutscher Einzelunternehmer handelte im Jahr 2021 über Plattformen wie OpenSea und Rarible mit sogenannten NFT-Collectibles – digitalen Bilddateien, die über Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain verkauft wurden.
Die NFTs wurden dabei nicht vom Kläger selbst erstellt, sondern als digitale Sammlerstücke weiterverkauft. Die Umsätze erklärte er mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %, da es sich seiner Ansicht nach um digitale Kunstwerke handle.
Das Finanzamt sah dies anders:
- NFTs seien keine körperlichen Kunstwerke,
- der Handel stelle eine sonstige elektronische Leistung dar,
- und der Regelsteuersatz von 19 % sei anzuwenden.
Daraufhin klagte der Händler – mit dem Argument, dass die Anonymität der Blockchain keine steuerbare Leistung zulasse und zudem ein Vollzugsdefizit bei der Finanzverwaltung bestehe.
Die zentrale Frage: Sind NFT-Transaktionen steuerbare Leistungen?
Das Gericht musste nun klären,
- ob der Handel mit NFTs überhaupt steuerbar ist,
- ob eine Lieferung oder sonstige Leistung vorliegt,
- wie der Ort der Leistung zu bestimmen ist,
- und ob Steuerbefreiungen oder ermäßigte Steuersätze greifen.
Die Entscheidung des FG Niedersachsen
a) NFT-Verkäufe sind umsatzsteuerbare Leistungen
Das Gericht stellte klar: Der Verkauf eines NFT ist eine sonstige Leistung nach § 3 Abs. 9 UStG, keine Lieferung.
NFTs sind rein digitale Wirtschaftsgüter ohne körperliche Substanz – sie verkörpern lediglich einen Blockchain-Eintrag, der die Eigentumszuordnung anzeigt.
Damit sind NFT-Transaktionen steuerbare Leistungen, sofern sie entgeltlich und unternehmerisch erfolgen.
b) Pseudonymität steht der Steuerpflicht nicht entgegen
Ein zentrales Argument des Klägers war, dass durch die Anonymität der Wallet-Adressen kein Leistungsempfänger erkennbar sei.
Das Gericht wies dies zurück:
„Die Pseudonymisierung der Krypto-Wallet-Adressen steht der Umsatzsteuerbarkeit nicht entgegen.“
Ähnlich wie bei anonymen Barverkäufen gilt auch hier: Die Identifizierbarkeit über Blockchain-Metadaten genügt.
c) Ort der Leistung: Elektronische Dienstleistung
Da die Käufer keine Unternehmer waren, gelten die NFT-Verkäufe als elektronisch erbrachte sonstige Leistungen (§ 3a Abs. 5 UStG).
Grundsätzlich ist damit der Wohnsitz des Käufers entscheidend.
Da der Kläger keine Nachweise über ausländische Käufer vorlegen konnte, schätzte das Gericht, dass 50 % der Umsätze im Inland steuerpflichtig sind.
d) Keine Anwendung der Dienstleistungskommission
Die Plattformen OpenSea und Rarible handeln nicht im eigenen Namen, sondern sind reine Vermittlungsportale. Die Fiktionsregelung des § 3 Abs. 11a UStG (Dienstleistungskommission) greift daher nicht – die Leistung erfolgt direkt vom Verkäufer an den Käufer.
e) Kein ermäßigter Steuersatz
NFTs gelten nicht als Kunstwerke im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (§ 12 Abs. 2 Nr. 7 c UStG). Auch die unionsrechtlichen Regelungen (MwStSystRL) schließen eine solche Ermäßigung für elektronisch erbrachte Leistungen aus.
f) Keine Steuerbefreiung als Finanzinstrument
NFTs verkörpern keine Forderungen oder standardisierten Rechte, die sie zu Wertpapieren machen würden. Daher sind weder § 4 Nr. 8 c UStG (Forderungsverkauf) noch § 4 Nr. 8 e UStG (Wertpapiere) anwendbar.
g) Kein strukturelles Vollzugsdefizit
Das Argument, die Finanzverwaltung könne den Handel technisch nicht erfassen, überzeugte das Gericht nicht. Über Blockchain-Analyse-Tools, Auskunftsersuchen (§ 93 AO) und internationale Zusammenarbeit sei die Kontrolle grundsätzlich möglich. Ein temporärer Vollzugsrückstand sei kein Verfassungsverstoß.
Kernaussagen und steuerliche Konsequenzen
| Thema | Entscheidung des FG Niedersachsen |
|---|---|
| Art der Leistung | Sonstige elektronische Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) |
| Ort der Leistung | Wohnsitz des Käufers (§ 3a Abs. 5 UStG) |
| Steuersatz | 19 % (kein ermäßigter Satz) |
| Zwischenhändler (OpenSea) | Keine Dienstleistungskommission (§ 3 Abs. 11a UStG) |
| Nachweispflichten | Verkäufer muss Empfängerort belegen |
| Pseudonymität | Kein Hinderungsgrund für Steuerpflicht |
| Vollzugsdefizit | Kein strukturelles Defizit im Sinne des GG |
Bedeutung für NFT-Händler und Künstler
Das Urteil schafft erstmals Rechtssicherheit für den deutschen NFT-Markt:
- NFT-Verkäufe sind grundsätzlich steuerpflichtig.
- 19 % Umsatzsteuer gilt als Regelsatz – unabhängig davon, ob es sich um Kunst oder Sammelobjekte handelt.
- Händler müssen Nachweise über den Ort des Leistungsempfängers erbringen, z. B. durch IP-Adressen, Geolokalisierung oder Zahlungsdaten.
- Pseudonymität schützt nicht vor Besteuerung.
- Plattformen wie OpenSea sind keine umsatzsteuerlichen Mittelsmänner.
Fazit: NFTs sind steuerlich kein Graubereich mehr
Das Urteil des FG Niedersachsen ist ein Meilenstein: Erstmals wird klar zwischen digitaler Kunst und elektronischer Dienstleistung unterschieden.
Für NFT-Händler bedeutet das:
- Eine korrekte Umsatzsteuererfassung ist Pflicht.
- Die Dokumentation der Käuferdaten gewinnt an Bedeutung.
- Bei internationalen Verkäufen sind künftig EU-OSS-Meldungen (One-Stop-Shop) relevant.
NFTs sind keine steuerfreie Kunst – sie sind digitale Dienstleistungen mit 19 % Umsatzsteuerpflicht. Damit endet die bisherige Unsicherheit im NFT-Markt – und die steuerliche Realität der Blockchain beginnt.